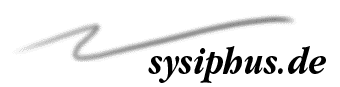
Warum Disketten?
In diesem Rechner steckt nur die neueste Technik: V90-Modem, USB, FastEthernet-Netzwerk, 3D-Grafikkarte, ... Das einzige, was noch alt war, war das Diskettenlaufwerk. Es braucht keiner mehr Disketten - also raus damit. Wer es unbedingt haben will, soll es einzeln kaufen. Aber nicht alle sollen diese Dinger kaufen müssen.
Apple-iMac-Presenter, MacWorld Expo 1998
In einem langen Leidensweg haben sich in den letzten 30 Jahren Disketten durch die EDV-Branche geschleppt: von den großformatigen Floppydisks, die im Laufe der Zeit auf 8 Zoll und 5,25 Zoll heruntergeschrumpft wurden bis hin zur 3,5 Zoll-Diskette mit einem festen Schutzgehäuse.
Geschichtsstunde für Quereinsteiger
Die Kombination aus 3,5"-Diskette und Diskettenlaufwerk ist älter, als oft angenommen: 1984/1985 setzten Apple, Atari und Commodore die Disketten in der DD-Variante (für Aufzeichnung doppelter Dichte und damit 720 kb, 800 kb und 880 kb pro Diskette) in ihren neuen Rechnern ein, in den IBM PS/2-Systemen wurde das 3,5"-Laufwerk für Disketten hoher Dichte (HD) das Standardlaufwerk.
Die 3,5"-Diskette hatte gegenüber der noch bis etwa 1992 in der PC-Branche häufig verwendeten 5,25"-Diskette viele Vorteile - man konnte sie nicht verkehrtherum einlegen, sie hatte ein relativ stabiles Kunststoffgehäuse, die Scheibe im Gehäuse lief auf einem weichen Vlies und nicht zuletzt bekam man auf weniger Raum mehr Daten unter.
Einseitiger Einsatzzweck auf zweiseitiger Scheibe
In den letzten 15 Jahren hat die Computerbranche in vielen Dingen Fortschritte gemacht - nur eines blieb immer: das Diskettenlaufwerk. Warum eigentlich?- Das Diskettenlaufwerk ist letztlich für viele Leute die einzige Möglichkeit, Daten auszulagern oder eine Sicherungskopie anzulegen.
- Lange Zeit war es Standard zur Installation von Anwendungssoftware oder Treibern.
- Disketten sind billige Medien, das Laufwerk ist in jedem Rechner enthalten. Man kann sich fast immer darauf verlassen, daß ein Datenaustausch-Partner die Hardware zur Verfügung hat, eine eigene Diskette zu lesen und zu beschreiben.
Doch diese Möglichkeiten geraten heute zunehmend in den Hintergrund: viele Anwender kopieren in ihre Dokumente Grafiken oder Fotos hinein, so daß allein schon aus Kapazitätsgründen das Diskettenlaufwerk nicht mehr reicht.
Verschiedene Anwendungssoftware reicht nicht einmal mehr aus, um auf nur einer CD-ROM ausgeliefert zu werden, bei aufwendiger Spielesoftware ist die Lieferung auf fünf, sechs oder sogar acht CDs üblich. Selbst die Treiber einer Grafikkarte passen heute nur mit Mühe auf eine Diskette.
Eigentlich bleibt da nur noch das letzte Argument: zum Datenaustausch.
Datenaustausch mit Problemen ...
Doch auch hier haben Disketten heute mehr Nachteile als Vorteile - Dokumente mit mehr als 1,4 MB muß man mit geeigneter Software komprimieren oder auf mehrere Disketten verteilen. Der Parter benötigt dann auch diese Software, das alte Argument vom "einfachen Austausch" greift nicht mehr, da nicht mehr nur die Hardware und das Betriebssystem stimmen müssen, sondern auch ein Teil der Anwendungssoftware.
Da die meiste Software für diesen Zweck als Freeware oder Shareware erhältlich ist, kommt man hier zum Glück nicht gleich in den Bereich der illegal kopierten Software.
Hat man die Daten einmal auf Diskette, kommt ein weiteres Problem hinzu, das erst seit wenigen Jahren auftritt: Disketten wuirden früher aufwendig getestet und mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Ein Zehnerpack 3,5"-Disketten kostete 1986 immerhin 120 DM, 1990 waren es dann immer noch 25 DM für ein Päckchen Markendisketten. Heute bekommt man so einen Diskettensatz für 3 DM, Grund ist hierfür der Druck von Markt und Käufern. Diese Ersparnis hat ihren Preis in der Qualität - denn diese entspricht längst nicht einmal mehr den Disketten von vor fünf Jahren.
So gilt der Aufdruck "100% fehlerfrei" oft nur wenige Tage oder Wochen im Einsatz, schreibt man Daten auf eine Diskette, so weiss keiner, ob man diese noch beim nächsten Mal wieder lesen kann. Der Transport größerer Datenmengen über Disketten wird so zur Qual, braucht man doch schon für 2 MB an Daten eigentlich drei Disketten: zwei für die Daten, eine weitere für die Komprimierungssoftware. Möchte man diese dann einlesen, so ist eine dieser drei Disketten nicht mehr zu lesen.
... und Risiken
Diskettenlaufwerke haben noch einen Nachteil an sich: sie haben keine festgelegten Servodaten, wie dies bei anderen Medien oder Festplatten der Fall ist. An dieser Servospur kann das Laufwerk so feststellen, ob die Daten von der korrekten Stelle aus richtig eingelesen wurden. Bei Disketten wird durch das Initialisieren der Diskette (oft auch als "Formatieren" bezeichnet) die reine Datenspur komplett neu aufgetragen, richtige Servodaten gibt es nicht. Stattdessen sind einfach die Abstände zwischen den Datenspuren festgelegt.
Da bei einer Diskette der Schreib-Lesekopf direkt auf dem Medium aufliegt und dieses darüberhinaus nur durch eine einfache Schiebeklappe vor Staub und Schmutz geschützt wird, kann so leicht Staub vor den Schreib-Lesekopf des Laufwerks gelangen, diese aus seiner Bahn gedrückt und so auf Dauer auch dejustiert werden. Fremde oder ältere eigene Disketten können nicht mehr gelesen werden.
Fatal ist dies, weil man den Fehler selbst nur schwer feststellen kann. Initialisiert man eine Diskette selbst neu, so schreibt das Laufwerk ja auch neue (entsprechend dem eigenen Laufwerk dejustierte) Spuren mit auf die Diskette und kann diese auch normal nutzen. Ein Tauschpartner kann mit der Diskette aber nicht viel anfangen, da sein Laufwerk nicht genauso justiert ist wie das eigene Laufwerk.
Wer Daten heute ausschließlich auf Disketten hält, kann diese praktisch genausogut gleich wegwerfen. Laufwerk und Technik sind längst nicht mehr zeitgemäß, die Datenmenge reicht nicht einmal mehr für heute übliche Dokumente.
Alternativen?
Hat man sich einmal vom Gedanken losgesagt, Disketten seien sicher oder auch nur eine gute Idee für die nächsten Monate, so stellt sich die Frage nach sinnvollen Alternativen. Die Frage beginnt man sinnigerweise gleich damit, wofür der Diskettenersatz gedacht ist - denn die möglichen Diskettennachfolger wie LS120 oder Sony-FIHD haben teilweise mit den gleichen Problemen zu kämpfen, an denen auch Disketten leiden.
LAN
Geht es um den Datenaustausch mit Rechnern, die im nächsten Raum stehen, so ist ein kleines Netzwerk auf den ersten Blick ein abwegiger Gedanke, doch die aktuellen Betriebssysteme sind alle für den Einsatz im Netzwerk gut gerüstet. Über Filesharing-Dienste kann man aus dem eigenen Arbeitsplatzrechner nebenbei einen Server für andere Rechner machen und auch direkt auf freigegebene Verzeichnisse anderer Rechner zugreifen.
Eine einfache Ethernet-Netzwerkkarte gibt es für 30 DM, dazu kommt noch ein Kabel und ggf. ein Verteiler (Hub), insgesamt kann für den Preis von zwei Diskettenlaufwerken (also etwa 100 DM) zwei-drei Rechner zu einem Netzwerk verbinden. Ein Netzwerk ermöglicht neben dem Austausch von Daten auch die gemeinsame Nutzung anderer Hardware wie z.B. einem Drucker.
Internet
So albern es auch klingen mag: kleine Datenmengen (das, was sonst auf eine Diskette passen würde) kann man in Zeiten von V.90 und ISDN durchaus per E-Mail verschicken. Der Tauschpartner sollte allerdings vorher wissen, daß da eine größere Nachricht kommt - hat er ein langsames Modem oder einen Provider, der seinen Kunden ein Größenlimit für E-Mail vergibt, so sollte man mit dem Tauschpartner vielleicht ein anderes Medium vereinbaren. E-Mail an sich bläht beim Transfer von Dokumenten auch diese Daten während des Transfers um etwa 30% auf, aus 1,4 MB werden so 2 MB im Transfer. Dies sollte man hier nicht außer acht lassen.
Für größere Datenmengen kann es auch geschickt sein, einfach etwas Plattenplatz eines freien Webservers mitzunutzen. Unter http://www.kostenlos.de/ findet man schnell ein Dutzend dieser Webspace-Anbieter. Dem Tauschpartner schickt man dann einfach per E-Mail die Webadresse, unter der die Daten liegen - und er kann sie sich bequem per Webbrowser abholen.
ZIP, JAZ und MO
Seit seiner Einführung 1994/1995 hat sich das ZIP-Laufwerk recht weit verbreitet, aber auch andere Systeme findet man oft. Hat der Tauschpartner auch das gleiche Laufwerk, so kann man diese gut zum Datenaustausch verwenden.
Auf ein spezielles 3,5"-Medium passen hierbei 100 MB beim "alten" ZIP-Laufwerk, 250 MB auf die neuen Medien für die neuen ZIP-Laufwerke. Auf den ersten Blick erscheinen die Laufwerke wie ZIP und JAZ recht günstig, der Haken kommt doch erst mit den Medien, immerhin kostet ein einzelnes 100-MB-Medium für ein ZIP-Laufwerk rund 25 DM, ein 1-GB-Medium fürs JAZ 150 DM. Ab etwa 5-10 Medien ist man schnell an der Grenze angelangt, an der andere Laufwerke günstiger wären.
Mehr oder minder ein Geheimtip sind die magneto-optischen Laufwerke. Bei den MO-Laufwerken wird die Scheibe des Mediums im Laufwerk erwärmt und erst dann kann der Schreib/Lesekopf das Medium beschreiben. Ausgelesen werden die Medien über ein optisches System - daher sind diese Medien gegen Magnetfelder recht gut geschützt. Der Haken an ihnen ist. daß sie sich leider nicht so weit verbreitet haben wie das ZIP und man auf jeden Fall mit dem Tauschpartner abklären sollte, ob das dortige MO im 3,5" oder 5,25"-Format arbeitet und welche Mediengrößen unterstützt werden.
Streamer
Geht es weniger darum, Daten mit anderen Leuten auszutauschen und eher darum, die eigenen Daten zu sichern, so bietet sich ein Bandlaufwerk (Streamer) an. Selbst ein kleiner DAT-Streamer bekommt 2 GB unkomprimiert und 4 GB per Hardwarekompression auf einem Band unter und so kann man leicht die gesamte Festplatte auf ein einzelnes Medium sichern, ohne wie bei den kleineren Medien alle Viertelstunde Medien wechseln zu müssen.
Der Preis von rund 800 DM schockt zuerst ein wenig, kann man einen Streamer doch nicht so einfach zum Datenaustausch oder zum Auslagern von Daten zweckentfremden, aber die mit 7 DM sehr günstigen Medien machen die Datensicherung in mehreren Sicherungsgenerationen wiederum interessant.
CDR und CDRW
CD-ROM-Laufwerke sind heute Standard im Computer - dementsprechend einfach ist es auch für einen Austauschspartner, eine CD zu lesen. Um CDs selbst zu schreiben, gibt es die CD-Brenner. Der Brenner an sich ist schon für 400 DM zu haben, die einzelnen Rohlinge kosten etwa 2,50 DM und sind jeweils nur einmal beschreibbar.
Auf CDRs kann man natürlich eine Menge an Daten unterbringen - für den Datenaustausch sind sie auch sehr gut geeignet. Je nach CD-Recording-Software kann man Dateien nur in einer speziellen Software zur CD zusammenstellen und "brennen" oder von der gewohnten Benutzeroberfläche aus den CD-Brenner wie ein normales Laufwerk benutzen.
Um dem abzuhelfen, wurden die CDRW-Laufwerke eingeführt: die speziellen (und auch teureren) Rohlinge kann man im CDRW-Brenner auch wieder löschen und insgesamt etwa 1000mal überschreiben. Ein Haken haben die CDRWs jedoch - sie sind nur in neueren, "multiread"-fähigen CD-Laufwerken lesbar, beschreibt man sie nicht mit spezieller Recording-Software, sondern mit sogenannter "Packet-Writing"-Software, so ist das dann verwendete Dateisystem nur auf neueren Rechnern lesbar.
DVD
Die "Digital Versatile Disc" soll auf lange Sicht einmal die CD-ROM ablösen. Auf eine CD-ROM passen etwa 650 MB an Daten, was für die ersten Softwarepakete, Multimedia-Anwendungen und digitale Videofilme aber auch schon zuwenig ist - in Konsequenz passen auf eine DVD-Scheibe bis zu 5,2 GB an Daten.
Rein äußerlich gleichen sich DVD-ROM und CD-ROM in Format und Aussehen, bei einer DVD-ROM werden die Daten jedoch ggf. auf beide Seiten und in mehreren Schichten aufgetragen - womit dann auch wieder ein neues Laufwerk zum Lesen fällig wird.
Während ein Gerät zum Schreiben von DVD-ROMs (DVD-Brenner) momentan noch zwischen 25000 und 30000 DM kostet, gibt es mit den DVD-RAM-Schreibern eine günstigere Alternative - das Laufwerk kostet etwas über 1000 DM, die DVD-RAM-Scheiben haben aber den Nachteil, daß sie sich von einer DVD-ROM deutlich unterscheiden und nur wenige DVD-ROM-Laufwerke auch DVD-RAMs lesen können.
Jahrelang hat sich die Unterhaltungsindustrie damit beschäftigt, einen Standard für Kopierschutzsysteme bei DVDs zu schreiben und damit die Einführung immer wieder verzögert, aus meiner Sicht wird sich DVD-RAM nicht so leicht durchsetzen können. Insbesondere die CD-Brenner graben trotz ihrer geringeren Kapazität viel Wasser ab.
|
Interessante Links
|